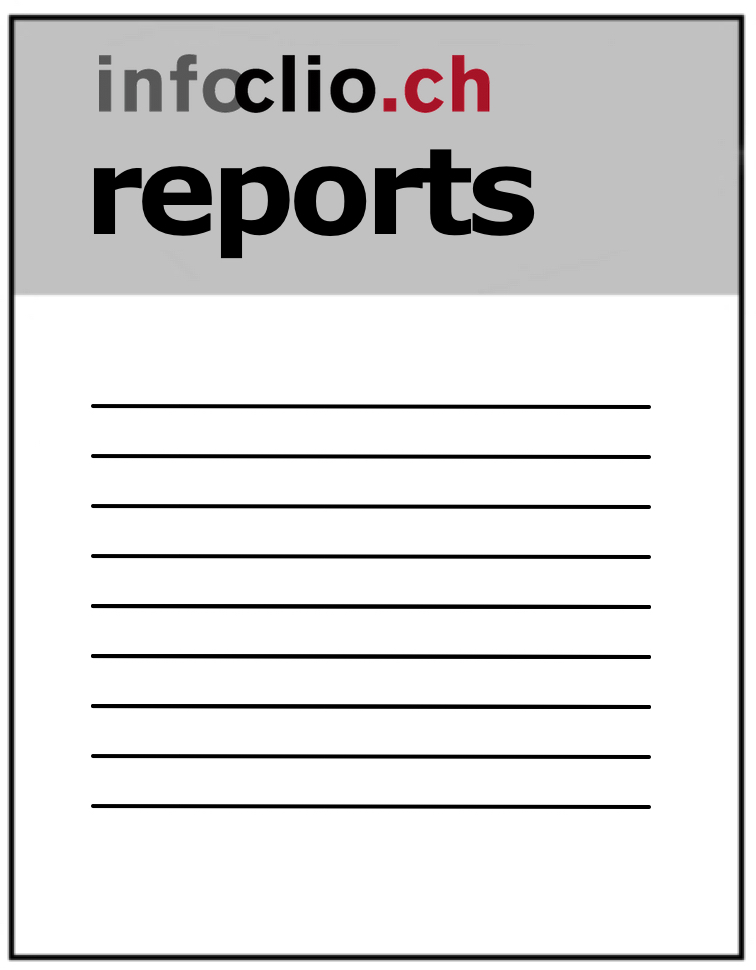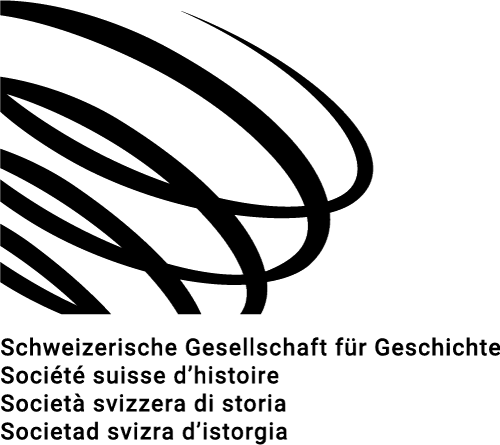Auf dieser Seite finden Sie die infoclio.ch-Dokumentation zu den 7. Schweizerischen Geschichtstagen. Die Inhalte wurden von einem Team bestehend aus 49 jungen Historikerinnen und Historikern produziert.
Die Inhalte dieses Reportings werden laufend ergänzt.
Eröffnungsfeier
- Valentin Groebner, Universität Luzern
- Sacha Zala, Präsident der Schweizerischen Gesellschaft für Geschichte (SGG)
- Martin Hartmann, Rektor der Universität Luzern
- Armin Hartmann, Bildungs- und Kulturdirektor des Kantons Luzerns
- Britta-Marie Schenk und Michael Räber, Universität Luzern
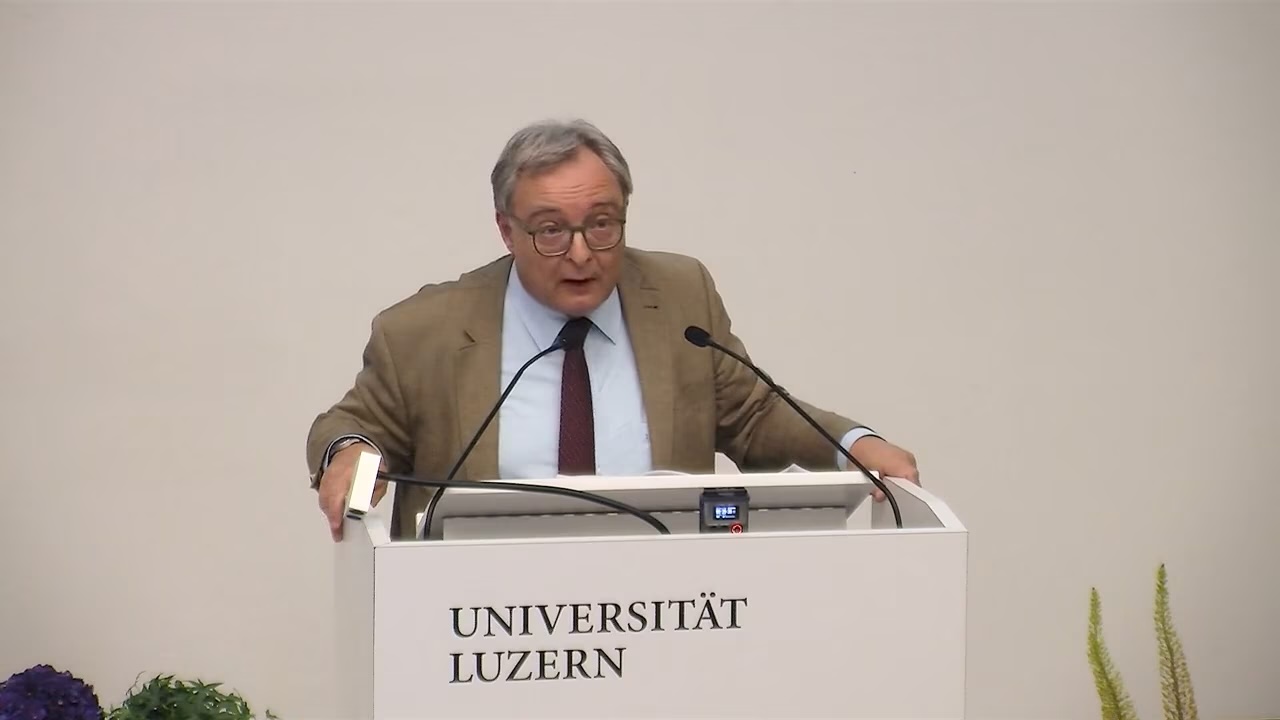
Photographing «history» – the paraphernalia of news coverage

War and the Political Work of Photography

Golden Secrets. Tax Havens and Gold Markets in the 20th and 21st Century

Podiumsberichte
Panelberichte
Antoon De Baets
Anlässlich ihrer Generalversammlung 2025 am 10. Juli 2025 verlieh die Schweizerische Gesellschaft für Geschichte (SGG) den Preis «lapis animosus» für die Forschungsfreiheit an Prof. em. Dr. Antoon De Baets (Universität Groningen), dem Gründer des Network of Concerned Historians.
Mit dem «lapis animosus» ehrt die SGG Personen, Projekte und Initiativen, die sich in besonderer Weise für die Förderung der Forschungsfreiheit in der Geschichtswissenschaft einsetzen.
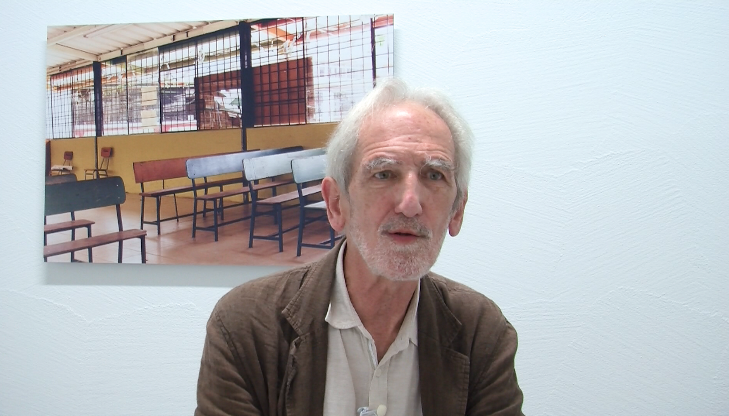
Anlässlich ihrer Generalversammlung 2025 am 10. Juli 2025 verlieh die Schweizerische Gesellschaft für Geschichte (SGG) den Preis «lapis animosus» für die Forschungsfreiheit an Prof. em. Dr. Antoon De Baets (Universität Groningen), dem Gründer des Network of Concerned Historians.
Mit dem «lapis animosus» ehrt die SGG Personen, Projekte und Initiativen, die sich in besonderer Weise für die Förderung der Forschungsfreiheit in der Geschichtswissenschaft einsetzen.
Marina Amstad, Marilyn Umurungi
Marilyn Umurungi und Marina Amstad (Schweizerisches Nationalmuseum) sprechen über die Ausstellung «kolonial – Globale Verflechtungen der Schweiz». Sie unterstreichen die Verantwortung von Museen, neue Forschung zum Kolonialismus offen zu vermitteln und einem breiten Publikum zugänglich zu machen.

Marilyn Umurungi und Marina Amstad (Schweizerisches Nationalmuseum) sprechen über die Ausstellung «kolonial – Globale Verflechtungen der Schweiz». Sie unterstreichen die Verantwortung von Museen, neue Forschung zum Kolonialismus offen zu vermitteln und einem breiten Publikum zugänglich zu machen.
Marina Amstad, Marilyn Umurungi
Marilyn Umurungi und Marina Amstad (Schweizerisches Nationalmuseum) sprechen über die Ausstellung «kolonial – Globale Verflechtungen der Schweiz». Sie unterstreichen die Verantwortung von Museen, neue Forschung zum Kolonialismus offen zu vermitteln und einem breiten Publikum zugänglich zu machen.

Marilyn Umurungi und Marina Amstad (Schweizerisches Nationalmuseum) sprechen über die Ausstellung «kolonial – Globale Verflechtungen der Schweiz». Sie unterstreichen die Verantwortung von Museen, neue Forschung zum Kolonialismus offen zu vermitteln und einem breiten Publikum zugänglich zu machen.
Izabel Barros
Izabel Barros (Université de Lausanne/UCR) studies a Swiss-owned plantation in southern Bahia in the 19th century. Her research connects Brazilian and Swiss history and, from the perspective of enslaved women and children, offers new insights into gender, motherhood, and slavery.

Izabel Barros (Université de Lausanne/UCR) studies a Swiss-owned plantation in southern Bahia in the 19th century. Her research connects Brazilian and Swiss history and, from the perspective of enslaved women and children, offers new insights into gender, motherhood, and slavery.
Lukas Becker, Olivier Keller
Lukas Becker (Universität Genf) und Olivier Keller (Universität Zürich) sprechen über ihr gemeinsames Panel «Contested Visibility – Labor and Modernity in Latin America». Sie erforschen Arbeit und Unternehmen in Lateinamerika im 20. Jahrhundert und machten in ihrem Panel Akteure sichtbar, die in den Quellen häufig unsichtbar bleiben.

Lukas Becker (Universität Genf) und Olivier Keller (Universität Zürich) sprechen über ihr gemeinsames Panel «Contested Visibility – Labor and Modernity in Latin America». Sie erforschen Arbeit und Unternehmen in Lateinamerika im 20. Jahrhundert und machten in ihrem Panel Akteure sichtbar, die in den Quellen häufig unsichtbar bleiben.
Lukas Becker, Olivier Keller
Lukas Becker (Universität Genf) und Olivier Keller (Universität Zürich) sprechen über ihr gemeinsames Panel «Contested Visibility – Labor and Modernity in Latin America». Sie erforschen Arbeit und Unternehmen in Lateinamerika im 20. Jahrhundert und machten in ihrem Panel Akteure sichtbar, die in den Quellen häufig unsichtbar bleiben.

Lukas Becker (Universität Genf) und Olivier Keller (Universität Zürich) sprechen über ihr gemeinsames Panel «Contested Visibility – Labor and Modernity in Latin America». Sie erforschen Arbeit und Unternehmen in Lateinamerika im 20. Jahrhundert und machten in ihrem Panel Akteure sichtbar, die in den Quellen häufig unsichtbar bleiben.
Philippe Bornet
Philippe Bornet (Université de Lausanne) étudie les relations entre l'Inde et l'Europe. Il associe l'histoire des religions, des missions et de l'orientalisme à des approches postcoloniales. À l'aide d'exemples tels que celui des femmes médecins missionnaires suisses en Inde, il évoque les liens qui lient les historiographies des deux pays.

Philippe Bornet (Université de Lausanne) étudie les relations entre l'Inde et l'Europe. Il associe l'histoire des religions, des missions et de l'orientalisme à des approches postcoloniales. À l'aide d'exemples tels que celui des femmes médecins missionnaires suisses en Inde, il évoque les liens qui lient les historiographies des deux pays.
Monika Dommann
Monika Dommann (Universität Zürich) spricht über ihre Forschung an den Schnittstellen von Wissenschafts-, Technik-, Wirtschafts- und Rechtsgeschichte, etwa zu Röntgenstrahlen als Medizinaltechnologie. Zudem spricht sie über die Aufarbeitung sexuellen Missbrauchs im Umfeld der katholischen Kirche, über die zentrale Rolle der Stimmen der Betroffenen dabei und über die Verantwortung der Forschenden ihnen gegenüber.

Monika Dommann (Universität Zürich) spricht über ihre Forschung an den Schnittstellen von Wissenschafts-, Technik-, Wirtschafts- und Rechtsgeschichte, etwa zu Röntgenstrahlen als Medizinaltechnologie. Zudem spricht sie über die Aufarbeitung sexuellen Missbrauchs im Umfeld der katholischen Kirche, über die zentrale Rolle der Stimmen der Betroffenen dabei und über die Verantwortung der Forschenden ihnen gegenüber.
Thomas Dworzak
Thomas Dworzak (Magnum Photos) spricht über seine Arbeit als Kriegsfotograf und über das Verhältnis zwischen Fotografie und Geschichte. Er reflektiert die digitale Bilderflut und hinterfragt KI-Bilder, die unzulässige Wirklichkeiten schaffen und unsere Wahrnehmungen prägen.

Thomas Dworzak (Magnum Photos) spricht über seine Arbeit als Kriegsfotograf und über das Verhältnis zwischen Fotografie und Geschichte. Er reflektiert die digitale Bilderflut und hinterfragt KI-Bilder, die unzulässige Wirklichkeiten schaffen und unsere Wahrnehmungen prägen.
Sophie Fäs
Sophie Fäs (Universität Basel) spricht über den Wandel von Haus- zu Spitalgeburten und die Rolle der Hebammen zwischen ärztlicher Kontrolle und Professionalisierung. Sie beschreibt, wie Hebammen die Verlagerung ins Spital vermittelten und wertet dazu unter anderem Beschwerdebriefe infolge schwieriger Geburten als Quellen aus.

Sophie Fäs (Universität Basel) spricht über den Wandel von Haus- zu Spitalgeburten und die Rolle der Hebammen zwischen ärztlicher Kontrolle und Professionalisierung. Sie beschreibt, wie Hebammen die Verlagerung ins Spital vermittelten und wertet dazu unter anderem Beschwerdebriefe infolge schwieriger Geburten als Quellen aus.
Elsa Gios
Elsa Gios (Università degli Studi di Napoli « L'Orientale ») étudie les pratiques antiracistes en Suisse, des syndicats aux collectifs féministes. À partir des études postcoloniales et des théories critiques de la race, elle analyse comment ces espaces produisent visibilité, savoirs et pouvoir d’agir politique.

Elsa Gios (Università degli Studi di Napoli « L'Orientale ») étudie les pratiques antiracistes en Suisse, des syndicats aux collectifs féministes. À partir des études postcoloniales et des théories critiques de la race, elle analyse comment ces espaces produisent visibilité, savoirs et pouvoir d’agir politique.
Leila Girschweiler
Leila Girschweiler (University of Zurich) studies Swiss companies in Argentina and Brazil during the military dictatorships. Her research illuminates their entanglements by bringing to light sources and scholarship pertaining to the Swiss and Latin American contexts, thereby fostering a dialogue between audiences in both regions.

Leila Girschweiler (University of Zurich) studies Swiss companies in Argentina and Brazil during the military dictatorships. Her research illuminates their entanglements by bringing to light sources and scholarship pertaining to the Swiss and Latin American contexts, thereby fostering a dialogue between audiences in both regions.
Kurt Gritsch
Kurt Gritsch (Kulturarchiv Oberengadin) untersucht Hotelangestellte in der Belle Époque. Mithilfe von Quellen aus St. Moritz, Meran und Lech am Aarlberg macht er die enge Verflechtung von Migration und Tourismus sichtbar. Saisonkräfte aus ganz Europa ermöglichten den Hotelbetrieb und liessen sich teilweise nach einigen Jahren dauerhaft nieder.

Kurt Gritsch (Kulturarchiv Oberengadin) untersucht Hotelangestellte in der Belle Époque. Mithilfe von Quellen aus St. Moritz, Meran und Lech am Aarlberg macht er die enge Verflechtung von Migration und Tourismus sichtbar. Saisonkräfte aus ganz Europa ermöglichten den Hotelbetrieb und liessen sich teilweise nach einigen Jahren dauerhaft nieder.
Jan Haugner
Jan Haugner (Universität Bern) forscht zur Lagerung und Zugänglichkeit von Staatsdokumenten in obrigkeitlichen Archiven der Alten Eidgenossenschaft. Seine Forschung zeigt, wie Geheimhaltung und fehlende Zugänglichkeit Unsichtbarkeit erzeugten, während die Archive im Zuge ihrer Professionalisierung im Republikanismus für die Politik nutzbar wurden und Legitimität schufen.

Jan Haugner (Universität Bern) forscht zur Lagerung und Zugänglichkeit von Staatsdokumenten in obrigkeitlichen Archiven der Alten Eidgenossenschaft. Seine Forschung zeigt, wie Geheimhaltung und fehlende Zugänglichkeit Unsichtbarkeit erzeugten, während die Archive im Zuge ihrer Professionalisierung im Republikanismus für die Politik nutzbar wurden und Legitimität schufen.
Bärbel Küster
Bärbel Küster (Universität Zürich) spricht über ihr Panel zu «Fotografie, Archiv und Erinnerungskultur». Diskutiert wurden private Aufnahmen einer Schweizer Militärmission in Korea, das digitalisierte fotografische Werk, das Annemarie Schwarzenbach 1941-42 im Kongo geschaffen hat, und wie europäische Fotobücher über Afrika das Afrikabild nachhaltig prägten.

Bärbel Küster (Universität Zürich) spricht über ihr Panel zu «Fotografie, Archiv und Erinnerungskultur». Diskutiert wurden private Aufnahmen einer Schweizer Militärmission in Korea, das digitalisierte fotografische Werk, das Annemarie Schwarzenbach 1941-42 im Kongo geschaffen hat, und wie europäische Fotobücher über Afrika das Afrikabild nachhaltig prägten.
Gabriella Lima
Gabriella Lima (Université de Lausanne) évoque les relations de la Suisse avec les institutions financières internationales et la diffusion des idées néolibérales dans les pays de la périphérie dans les années 1970-1990. Elle mentionne aussi les liens économiques de la Suisse avec le Brésil pendant la dictature militaire.

Gabriella Lima (Université de Lausanne) évoque les relations de la Suisse avec les institutions financières internationales et la diffusion des idées néolibérales dans les pays de la périphérie dans les années 1970-1990. Elle mentionne aussi les liens économiques de la Suisse avec le Brésil pendant la dictature militaire.
Jasmine Lovey
Jasmine Lovey (Université de Fribourg) étudie les campagnes de vaccination contre la variole au début du XIXe siècle à Fribourg, Vaud et Neuchâtel. Ses recherches montrent que les enfants eux-mêmes, bien qu’au centre des interventions sanitaires, sont largement invisibilisés dans les sources administratives.

Jasmine Lovey (Université de Fribourg) étudie les campagnes de vaccination contre la variole au début du XIXe siècle à Fribourg, Vaud et Neuchâtel. Ses recherches montrent que les enfants eux-mêmes, bien qu’au centre des interventions sanitaires, sont largement invisibilisés dans les sources administratives.
Fabienne Meyer
Fabienne Meyer (Universität Freiburg) untersucht die Praxis der Schweizer Behörden gegenüber NS-Opfern im Spannungsfeld zwischen Neutralitätspolitik und Schutzauftrag gegenüber der Schweizer Bevölkerung und fokussiert dabei auf diplomatische Handlungsspielräume. Ihr Interesse gilt zudem der Erinnerungskultur, von Holocaust-Denkmälern bis zum geplanten Erinnerungsort in Bern, wobei sie auch die Rolle des digitalen Raums reflektiert.

Fabienne Meyer (Universität Freiburg) untersucht die Praxis der Schweizer Behörden gegenüber NS-Opfern im Spannungsfeld zwischen Neutralitätspolitik und Schutzauftrag gegenüber der Schweizer Bevölkerung und fokussiert dabei auf diplomatische Handlungsspielräume. Ihr Interesse gilt zudem der Erinnerungskultur, von Holocaust-Denkmälern bis zum geplanten Erinnerungsort in Bern, wobei sie auch die Rolle des digitalen Raums reflektiert.
Mikhaël Moreau
Mickaël Moreau (Université de Lausanne) mène ses recherches dans le cadre du projet FNS MEDIF sur les premières femmes médecins en Suisse et en France. Sa thèse étudie leurs réseaux transnationaux et stratégies d’alliance ainsi que le « féminisme médical » né avec l’ouverture des facultés dès les années 1860.

Mickaël Moreau (Université de Lausanne) mène ses recherches dans le cadre du projet FNS MEDIF sur les premières femmes médecins en Suisse et en France. Sa thèse étudie leurs réseaux transnationaux et stratégies d’alliance ainsi que le « féminisme médical » né avec l’ouverture des facultés dès les années 1860.
Jonathan Pärli
Angelehnt an Jacques Rancières Ansatz der sinnlichen Wahrnehmung, zeigt Jonathan Pärli (Universität Basel) in seinem Buch «Die andere Schweiz», wie der Asylaktivismus in den 1970er und 1980er Jahren unsichtbare Praktiken der Behörden öffentlich machte. Er spricht zudem über die Bedeutung von Quellenkritik im Zeitalter von KI und über den «lapis animosus», einen Preis für Forschungsfreiheit, den er vor drei Jahren gewonnen hat.

Angelehnt an Jacques Rancières Ansatz der sinnlichen Wahrnehmung, zeigt Jonathan Pärli (Universität Basel) in seinem Buch «Die andere Schweiz», wie der Asylaktivismus in den 1970er und 1980er Jahren unsichtbare Praktiken der Behörden öffentlich machte. Er spricht zudem über die Bedeutung von Quellenkritik im Zeitalter von KI und über den «lapis animosus», einen Preis für Forschungsfreiheit, den er vor drei Jahren gewonnen hat.
Sarah Rindlisbacher Thomi
Sarah Rindlisbacher Thomi (Universität Bern) forschte über Zürcher Geistliche im 17. Jahrhundert als bislang übersehene Akteure der Aussenpolitik. Sie zeigt, wie Religion diplomatische Prozesse prägte, und macht die bewusst unsichtbar gehaltene Rolle der Geistlichen sichtbar.

Sarah Rindlisbacher Thomi (Universität Bern) forschte über Zürcher Geistliche im 17. Jahrhundert als bislang übersehene Akteure der Aussenpolitik. Sie zeigt, wie Religion diplomatische Prozesse prägte, und macht die bewusst unsichtbar gehaltene Rolle der Geistlichen sichtbar.
Bernhard C. Schär
Bernhard C. Schär (Université de Lausanne) forscht zur Schweiz im 19. Jahrhundert aus einer globalgeschichtlichen Perspektive, die die eurozentrischen Modelle der Geschichtsschreibung überwinden und die Präsenz unsichtbar gemachter Akteure in der modernen Welt aufzeigen will. Er geht zudem auf die Ambivalenz des technologischen Wandels für die Globalgeschichte ein und warnt vor neokolonialen Mustern bei der Digitalisierung von Archiven des Globalen Südens.

Bernhard C. Schär (Université de Lausanne) forscht zur Schweiz im 19. Jahrhundert aus einer globalgeschichtlichen Perspektive, die die eurozentrischen Modelle der Geschichtsschreibung überwinden und die Präsenz unsichtbar gemachter Akteure in der modernen Welt aufzeigen will. Er geht zudem auf die Ambivalenz des technologischen Wandels für die Globalgeschichte ein und warnt vor neokolonialen Mustern bei der Digitalisierung von Archiven des Globalen Südens.
Andrea Schneider-Braunberger
Andrea Schneider-Braunberger (Gesellschaft für Unternehmensgeschichte) spricht über neue Quellen und wie diese Vergessenes sichtbar machen können. Sie betont die Bedeutung wissenschaftlicher Unabhängigkeit in der Auftragsforschung und die Chancen, durch den Zugang zu Firmenarchiven einzigartige interne Quellen zu erschliessen, die neue Einsichten für die Forschung und eine transparente Unternehmenskommunikation ermöglichen.

Andrea Schneider-Braunberger (Gesellschaft für Unternehmensgeschichte) spricht über neue Quellen und wie diese Vergessenes sichtbar machen können. Sie betont die Bedeutung wissenschaftlicher Unabhängigkeit in der Auftragsforschung und die Chancen, durch den Zugang zu Firmenarchiven einzigartige interne Quellen zu erschliessen, die neue Einsichten für die Forschung und eine transparente Unternehmenskommunikation ermöglichen.
Michèle Steiner
Michèle Steiner (Universität Basel) untersucht Frauenklöster in Solothurn im 17. und 18. Jh. Sie zeigt, wie Mobilität von Personen und Dingen den Klosterraum prägte, und nutzt materielle Objekte wie Kelche, Kunstblumen oder Andachtsbilder, um Beziehungsnetze und verborgene Praktiken sichtbar zu machen.

Michèle Steiner (Universität Basel) untersucht Frauenklöster in Solothurn im 17. und 18. Jh. Sie zeigt, wie Mobilität von Personen und Dingen den Klosterraum prägte, und nutzt materielle Objekte wie Kelche, Kunstblumen oder Andachtsbilder, um Beziehungsnetze und verborgene Praktiken sichtbar zu machen.
Noemi Steuerwald
Noemi Steuerwald (Universität Bern) untersucht den Reitsport aus kultur- und geschlechtergeschichtlichen Perspektiven. Sie macht dabei gleichwohl Tiere als Subjekte, die Lebenswelten von Frauen und Männerbilder im Pferdesport sichtbar und zeigt, wie Fotografien Einblicke in Praktiken und die materielle Kultur des Reitens geben.

Noemi Steuerwald (Universität Bern) untersucht den Reitsport aus kultur- und geschlechtergeschichtlichen Perspektiven. Sie macht dabei gleichwohl Tiere als Subjekte, die Lebenswelten von Frauen und Männerbilder im Pferdesport sichtbar und zeigt, wie Fotografien Einblicke in Praktiken und die materielle Kultur des Reitens geben.
Simon Teuscher
Simon Teuscher (Universität Zürich) spricht über das Projekt Weltgeschichte der Schweiz. In rund 100 kurzen Beiträgen werden Orte und Daten vorgestellt, die zeigen, wie stark die Schweiz seit der Vormoderne in globale Zusammenhänge eingebunden ist – weit über eine nationale Geschichtsschreibung hinaus.

Simon Teuscher (Universität Zürich) spricht über das Projekt Weltgeschichte der Schweiz. In rund 100 kurzen Beiträgen werden Orte und Daten vorgestellt, die zeigen, wie stark die Schweiz seit der Vormoderne in globale Zusammenhänge eingebunden ist – weit über eine nationale Geschichtsschreibung hinaus.
Carola Togni
Carola Togni (Haute École de Travail Social et de la Santé, Lausanne) récapitule les défis méthodologiques liés à l’écriture de l’histoire des femmes et des mouvements féministes. Elle évoque les relations entre activistes et chercheuses, les décalages ou malentendus qui peuvent naître des collaborations, et l’importance de la notion de savoir situé.

Carola Togni (Haute École de Travail Social et de la Santé, Lausanne) récapitule les défis méthodologiques liés à l’écriture de l’histoire des femmes et des mouvements féministes. Elle évoque les relations entre activistes et chercheuses, les décalages ou malentendus qui peuvent naître des collaborations, et l’importance de la notion de savoir situé.
Lukas Becker, Olivier Keller
Alix Vogel (Institut de psychologie, Université de Lausanne) et Amélie Puche (Institut des Humanités en médecine, CHUV-UNIL) mènent leurs recherches dans le cadre du projet MEDIF sur les femmes médecins en Suisse et en France (1867–1939). Elles présentent leurs sources et thèmes de recherche et discutent des raisons de l’invisibilisation des femmes dans l’histoire de la médecine.

Alix Vogel (Institut de psychologie, Université de Lausanne) et Amélie Puche (Institut des Humanités en médecine, CHUV-UNIL) mènent leurs recherches dans le cadre du projet MEDIF sur les femmes médecins en Suisse et en France (1867–1939). Elles présentent leurs sources et thèmes de recherche et discutent des raisons de l’invisibilisation des femmes dans l’histoire de la médecine.
Lukas Becker, Olivier Keller
Alix Vogel (Institut de psychologie, Université de Lausanne) et Amélie Puche (Institut des Humanités en médecine, CHUV-UNIL) mènent leurs recherches dans le cadre du projet MEDIF sur les femmes médecins en Suisse et en France (1867–1939). Elles présentent leurs sources et thèmes de recherche et discutent des raisons de l’invisibilisation des femmes dans l’histoire de la médecine.

Alix Vogel (Institut de psychologie, Université de Lausanne) et Amélie Puche (Institut des Humanités en médecine, CHUV-UNIL) mènent leurs recherches dans le cadre du projet MEDIF sur les femmes médecins en Suisse et en France (1867–1939). Elles présentent leurs sources et thèmes de recherche et discutent des raisons de l’invisibilisation des femmes dans l’histoire de la médecine.
Jasper Walgrave
Jasper Walgrave (University of Fribourg) studies cultural relations between Switzerland and South Africa during apartheid. Cultural cooperation, supported by actors with ideological positions aligned to white supremacist thought and thus apologetic of the apartheid regime, declined during the 1980s so as not to harm Swiss economic interests in South Africa as condemnation of the apartheid regime gained visibility.

Jasper Walgrave (University of Fribourg) studies cultural relations between Switzerland and South Africa during apartheid. Cultural cooperation, supported by actors with ideological positions aligned to white supremacist thought and thus apologetic of the apartheid regime, declined during the 1980s so as not to harm Swiss economic interests in South Africa as condemnation of the apartheid regime gained visibility.