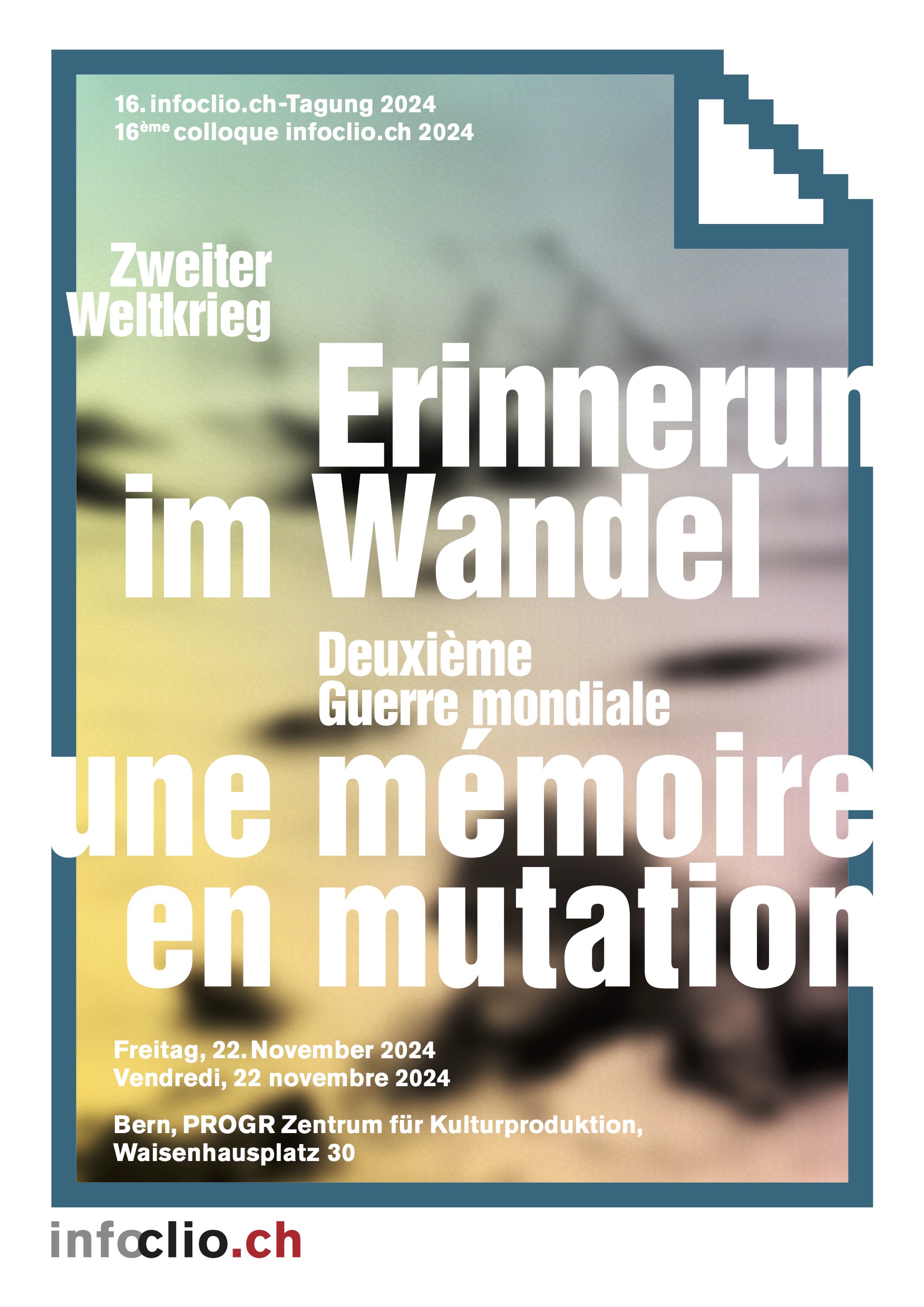Beitrag von Fabienne Meyer, Universität Freiburg
Seit 1992 verlegt der Künstler Gunter Demnig in ganz Europa Stolpersteine in Erinnerung an Menschen, die in der Zeit des Nationalsozialismus verfolgt, ermordet, deportiert oder vertrieben wurden. Die Steine werden in der Regel vor den Gebäuden verlegt, in denen die Menschen ihren letzten selbstgewählten Wohnsitz vor der Verfolgung hatten. Seit November 2020 begegnen Passantinnen und Passanten auch in Zürich, Basel, Winterthur, Bern, St. Gallen und Brissago diesen kleinen Messingsteinen.
Seit einigen Jahren wächst das Bewusstsein darüber, dass auch Schweizer Staatsangehörige und hier Geborene, die im Deutschen Reich oder in den besetzten Gebieten gelebt haben, vom nationalsozialistischen Regime verfolgt wurden. Einige auf der Grundlage der «Nürnberger Rassengesetze», andere, weil sie sich dem politischen Widerstand angeschlossen hatten, wieder andere aus blosser Willkür. Statt diesen Schweizerinnen und Schweizern an ihrem letzten Wohnort in Frankreich, Deutschland oder Österreich ein Erinnerungszeichen zu setzen, hat sich der Verein Stolpersteine Schweiz dazu entschieden, dieses Bewusstsein auch auf den Strassen der Schweiz vor denjenigen Wohnhäusern sichtbar zu machen, in denen die Personen vor ihrer Auswanderung gelebt hatten.
Dass diese Geschichten von Schweizer NS-Opfern oder solchen, die einen engen Bezug zur Schweiz hatten, erst heute – unter anderem in Form von Stolpersteinen – sichtbar werden, kann hauptsächlich mit zwei historiographischen Zäsuren begründet werden: Die erste Zäsur ist in der Mitte der 1990er-Jahre zu verorten, als die vom Bundesrat eingesetzte Expertenkommission, die sogenannte Bergier-Kommission, damit begann, die wirtschaftlichen Verflechtungen mit dem Deutschen Reich, die nachrichtenlosen Vermögen auf Schweizer Bankkonten und die restriktive Flüchtlingspolitik wissenschaftlich fundiert aufzuarbeiten. Diese Zäsur markierte ein «Davor» und ein «Danach», in denen je unterschiedliche Narrative vorherrschten, die wir bis heute in der Denkmallandschaft der Schweiz wiederfinden.
Das «Davor» war geprägt vom Narrativ der «humanitären Insel Schweiz», die sich die Kriegsverschonung mit einer erfolgreichen Neutralitätspolitik und einer wirkungsvollen geistigen und militärischen Landesverteidigung erklärte. Manifestiert hat sich dieses Narrativ in Form von Stelen, Skulpturen, Gedenktafeln und Obelisken in Erinnerung an den Wehrdienst. In der direkten Nachkriegszeit wurden diejenigen Denkmäler, die bereits nach dem Ersten Weltkrieg für verstorbene Schweizer Soldaten erstellt worden waren, mit neuen Inschriften, Namen und Daten ergänzt, mancherorts wurden auch neue Denkmäler erschaffen.

Abb. 1: Gedenkstein für die im Aktivdienst während des Ersten und Zweiten Weltkrieges verstorbenen Soldaten, Schaffhausen, 1921 (ergänzt nach dem Zweiten Weltkrieg). Foto: Fabienne Meyer
Auf über 200 Erinnerungszeichen – von monumentalen Skulpturen bis hin zu einfachen Inschriften an Bunkerwänden – werden die Leistungen und Entbehrungen der beiden Aktivdienstgenerationen thematisiert. Hunderte Namen von hauptsächlich durch Unfälle oder Krankheiten verstorbenen Soldaten zieren die Denkmaltopografie der kriegsverschonten Schweiz.1
Diese Soldatendenkmäler gründen zum einen auf dem Bedürfnis, sich in eine gesamteuropäische Kultur des Soldatengedenkens einzugliedern. Zum anderen sind sie Ausdruck einer Bevölkerung, die in der Nachkriegszeit ihre Anteilnahme und Dankbarkeit gegenüber der Landesverteidigung in Stein meisselte. Denn solche Denkmäler bekunden immer ausgewählte Werte oder Empfindungen, die zur Zeit ihrer Entstehung relevant und sagbar waren und die in die Zukunft transportiert werden sollen. In jeder Gegenwart, in jeder Generation, wird das, was sagbar ist und was verewigt werden soll, von Neuem ausgehandelt, weil neue Erkenntnisse, neue Werte, neue Erfahrungen hinzukommen. Neben dem Sagbaren gibt es in jeder Zeit auch Unsagbares. Das Unausgesprochene entspricht dabei nicht zwingend dem willkürlichen Vergessen von Irrelevantem, sondern eher dem aktiven Ausblenden und Beschweigen von Unangenehmem und Traumatischem.
So geschah es in der Nachkriegszeit mit den Opfern des Nationalsozialismus und des Holocaust – europaweit, aber auch in der Schweiz. Zwar wurden hier schon früh einzelne Gedenksteine und Skulpturen für die jüdischen Opfer errichtet, allerdings im halböffentlichen Raum jüdischer Friedhöfe und selbstständig von jüdischen Gemeinden. Weil Denkmäler jedoch Abbilder von politischen Debatten, gesellschaftlichen Entwicklungen oder wissenschaftlichen Erkenntnissen sind, hat sich die historiographische Zäsur Mitte der 1990er-Jahre auch in der Denkmallandschaft niedergeschlagen.
Im «Danach» hatte sich das, was sagbar und darstellbar ist, gewandelt. Nun thematisierten Gedenktafeln auch im öffentlichen Raum die Schweizer Flüchtlingspolitik während des Zweiten Weltkriegs. Strassennamen und Tafeln riefen die couragierten Fluchthelferinnen und -helfer ins Gedächtnis und neue Skulpturen erinnerten an die sechs Millionen Jüdinnen und Juden, die im Holocaust ermordet wurden. Nicht nur auf jüdischen Friedhöfen, auch an Grenzübergängen, ehemaligen Wohnhäusern von Fluchthelferinnen und -helfern oder Verstecken von Flüchtlingen machen heute über 60 Denkmäler auf Geschichten und Namen aufmerksam. Es sind keine monumentalen Gedenkstätten, sondern einzelne Wegmarken, die eher zufällig entdeckt werden. Es sind Artefakte lokaler Prägung, die meist unscheinbar und an unauffälligen Standorten ihre eindringlichen Geschichten erzählen.2
Nicht staatliche oder kantonale Initiativen waren die treibenden Faktoren für die Entstehung dieser Holocaust-Denkmäler in der Schweiz. Sie basierten vielmehr auf den Anregungen und Bemühungen von interessierten Privatpersonen, von jüdischen oder politischen Gemeinden, von Historikerinnen und Künstlern. Diese «bottom-up-Kultur» ist sehr typisch für die subsidiär organisierte, föderalistische Schweiz. Einzelne engagierte Menschen fühlten sich dazu veranlasst, bleibende Zeichen für meist konkret ortsbezogene Geschichten zu setzen und aus einem Fundus an möglichen Erzählungen jene auszuwählen, die über Generationen fortbestehen sollen.
Ein Grossteil dieser Denkmäler, die nach Mitte der 1990er-Jahre entstanden sind, ist der Zivilcourage konkreter Persönlichkeiten gewidmet, die sich während des Zweiten Weltkriegs für Flüchtlinge und Verfolgte eingesetzt oder sich durch ideologischen Widerstand gegen den Nationalsozialismus gestellt hatten. Sie erinnern an die Fluchthelferinnen und -helfer, die im Grenzgebiet zu Frankreich Flüchtlingen über die Grenze geholfen und dabei ihr eigenes Leben aufs Spiel gesetzt haben. Sie erinnern an Carl Lutz oder Ernst Prodolliet, die als Schweizer Diplomaten in Budapest respektive in Bregenz zur Rettung von mehreren tausend Jüdinnen und Juden beigetragen haben. Und sie erinnern an den Polizeikommandanten Paul Grüninger, der 1938 nach dem Anschluss Österreichs gegen die Weisungen verstossen hat und mehrere hundert, vielleicht auch einige tausend Flüchtlinge den Rhein passieren und in die Schweiz einreisen liess.
Abb. 2: Stele für Fluchthelferinnen und -helfer zwischen Frankreich und der Schweiz, Le Pont VD, 2014. Foto: Fabienne Meyer
Die Schweizer Helferinnen und Helfer und ihre Leistungen werden auf diesen Denkmälern als couragiert, gewissenhaft, idealistisch oder selbstlos bezeichnet. Implizit weisen einige der Denkmäler darauf hin, dass ihre Hilfeleistungen gegen die Weisungen und das geltende Recht verstossen haben. Im Falle von Paul Grüninger wird auch erwähnt, dass er «1939 fristlos aus dem Polizeidienst entlassen und wegen Amtspflichtverletzung und Urkundenfälschung verurteilt» wurde.3 Diese Denkmäler reflektieren also nicht das Bild einer couragierten, humanitären Schweiz, sie zeigen vielmehr, dass die einzelnen Persönlichkeiten, an die erinnert wird, individuell gehandelt und sich aus persönlicher Überzeugung gegen die Norm und das Gesetz erhoben haben.
Andere Gedenktafeln gehen explizit und kritisch auf die Schweizer Flüchtlingspolitik während der Zeit des Nationalsozialismus ein. Auf einem kleinen Gedenkstein auf dem jüdischen Friedhof in Bern wird an das junge Ehepaar Céline und Simon Zagiel-Mokobodzki erinnert, die im August 1942 von Belgien in die Schweiz flohen, auf dem jüdischen Friedhof in Bern aufgegriffen und von der Fremdenpolizei nach Frankreich ausgeschafft wurden. Von Frankreich wurden sie nach Auschwitz deportiert, wo die 17-jährige Céline ermordet wurde. Der 21-jährige Simon überlebte das Konzentrationslager. Sie werden auf dem Gedenkstein als «victimes de la politique de la barque pleine»4 bezeichnet, also als Opfer der Politik des «vollen Bootes». Mit diesem Ausdruck hatte der damalige Schweizer Justizminister Eduard von Steiger im Sommer 1942 die restriktive Flüchtlingspolitik begründet und das Bild vermittelt, die Schweiz könne als schon fast volles Rettungsboot kaum weitere Flüchtlinge aufnehmen.

Abb. 3: Gedenkstein für Céline und Simon Zagiel-Mokobodzki auf dem jüdischen Friedhof in Bern, 1997. Foto: Fabienne Meyer
Andere Denkmäler erwähnen die geschlossenen Grenzen, die abgewiesenen und ausgeschafften Flüchtlinge oder die gesellschaftliche Ablehnung der Verfolgten. Dabei wird nicht nur auf die abweisende Haltung der Schweiz verwiesen, es fällt immer auch ein positives Wort, etwa weil zahlreiche Flüchtlinge hier Zuflucht gefunden hatten oder weil sich gewisse Fluchthelferinnen und -helfer für sie eingesetzt haben. Die Denkmäler zeugen von einer Dialektik zwischen Verfolgung und Ablehnung auf der einen Seite und Zuflucht und Dankbarkeit auf der anderen Seite. So erinnert eine Gedenktafel am Ostschweizer Rheinufer an die jüdischen Flüchtlinge, die sich an dieser Stelle in die Schweiz retten konnten, sowie an die Menschen, die den Flüchtenden über die Grenze halfen. Sie erinnert aber auch an die Verfolgten, die nach der Grenzschliessung der Schweiz in den sicheren Tod geschickt wurden. Eine weitere Skulptur in Genf, angefertigt von der israelischen Künstlerin Dina Merhav, wurde 1998 von ehemaligen internierten Flüchtlingen als Dank für die gewährte Zuflucht gespendet. Die damalige Bundesrätin Ruth Dreifuss nutzte die Einweihungsfeier, um in ihrer Ansprache auf die Widersprüchlichkeit des Verhaltens der Schweiz hinzuweisen. Die Skulptur erinnere einerseits an die aufgenommenen Flüchtlinge, anderseits aber auch an alle abgewiesenen Hilfesuchenden und damit auch daran, dass die Schweiz während der Zeit des Zweiten Weltkriegs ihre Möglichkeiten zum Schutz der Flüchtenden nicht voll ausgeschöpft hat.5

Abb. 4: Skulptur «Wings of Peace» von Dina Merhav, Genf, 1998. Foto: Fabienne Meyer
Erst mit der kritischen Auseinandersetzung mit der Geschichte der Schweiz während des Zweiten Weltkriegs wurden diese Denkmäler möglich und ihre Inschriften sagbar. Inhaltlich hat sich die Erinnerungskultur in der Schweiz allmählich an die europäische angeglichen. Formell aber hat die Schweiz mit ihren sehr niederschwelligen Denkmälern für den Holocaust einen deutlichen «Sonderweg» eingeschlagen, was insbesondere daran liegt, dass der Holocaust als etwas ausserhalb Liegendes verstanden wurde – teilweise bis heute. Heute aber werden wir, so scheint es, Zeugen eines neuen Paradigmenwechsels, einer zweiten Zäsur, die wiederum ein «Davor» und ein «Danach» markiert und sich in neuen Formen und Inhalten ebenso wie in neuen Trägerschaften von Denkmälern manifestiert. Denn das Interesse an der Geschichte der Schweizer Opfer des Nationalsozialismus hat sich jüngst nicht nur in Form von Stolpersteinen niedergeschlagen. Es war auch Anlass für die Formierung einer zivilgesellschaftlichen Arbeitsgruppe, die ein Konzept für einen nationalen Erinnerungsort in der Schweiz erarbeitet hat, der unter anderem auch an die Schweizer Opfer des Nationalsozialismus erinnern soll. Gemäss zwei breit abgestützten parlamentarischen Forderungen aus dem Jahr 2021, die sich auf diese Initiative stützten, soll dieser Ort «die Erinnerung wachhalten und durch Vermittlungsarbeit das Bewusstsein für die Bedeutung von Demokratie und Rechtsstaat, insbesondere bei jungen Menschen, stärken».6
Im April 2023 hat sich die Landesregierung schliesslich für die Schaffung eines Schweizer Erinnerungsortes für die Opfer des Nationalsozialismus ausgesprochen. Entstehen soll ein gesamtschweizerisches Projekt mit einem zentralen Gedenkort in der Bundesstadt Bern und einem Vermittlungszentrum zum Thema Flucht im St. Galler Rheintal. Ein nationales Netzwerk soll darüber hinaus die unterschiedlichen Initiativen zur Aufrechterhaltung der Erinnerung an und des Wissens über die Folgen des Nationalsozialismus in der Schweiz zusammenbringen und miteinander vernetzen.7
Nach dem Paradigmenwechsel um die Jahrtausendwende, mit dem auch kritische Erinnerungen an die Zeit des Zweiten Weltkriegs im öffentlichen Raum sag- und sichtbar wurden, erleben wir heute mit der Planung eines Schweizer Erinnerungsortes für die Opfer des Nationalsozialismus also einen zweiten Paradigmenwechsel im Verständnis und in Bezug auf die Gestaltung der Denkmallandschaft: Nämlich hin zu einem Bewusstsein, dass es Ereignisse und Geschichten gibt, für die eine subsidiäre Denkmalkultur nicht mehr ausreicht – die vielmehr auch auf staatlicher Ebene erinnerungswürdig, ja erinnerungspflichtig sind. Nicht nur als stille Zeichen, sondern auch als Vermittlungs- und Aufklärungsort, als Netzwerk in gesamtheitlicher Betrachtungsweise. Mit ihrem 2004 erfolgten Beitritt zur International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) hatte sich die Schweiz verpflichtet, «die Erinnerung an den Holocaust aufrechtzuerhalten und jüngeren Generationen die Gräuel des Holocaust zur Kenntnis zu bringen, damit junge Menschen ein Bewusstsein entwickeln können, zu was Rassismus, Antisemitismus und Diskriminierung führen können».8 Der nun in Entstehung begriffene Erinnerungsort ist eine Möglichkeit, dieses Versprechen einzulösen: Nicht «top down» oder als Ersatz für Stolpersteine, Gedenktafeln und Skulpturen, deren Initiativen weiterhin wertvoll sind, um die lokalen Geschichten in die Landschaft einzubrennen, sondern verankert in einer breiten Trägerschaft und als Ergänzung der lokal entstandenen Erinnerungszeichen. Wie nachhaltig diese für die Schweiz neue Erinnerungs- und Gedenkform sein wird und ob sie zu einer vertieften und breiten Auseinandersetzung mit der Vergangenheit sowie zu einem reflektierten Umgang mit den Herausforderungen der Gegenwart und der Zukunft anregen kann, wird sich erst zeigen müssen.
Anmerkungen
1 Vgl. dazu das Inventar der Armee- und Kriegsdenkmäler, veröffentlicht durch die Schweizer Armee: <https://www.vtg.admin.ch/de/inventario> [Stand: 18.09.2024].
2 Vgl. dazu Meyer, Fabienne: Monumentales Gedächtnis. Shoah-Denkmäler in der Schweiz, in: Azaryahu, Maoz; Gehring, Ulrike; Meyer, Fabienne; Picard, Jacques; Späti, Christina (Hg.): Erzählweisen des Sagbaren und Unsagbaren. Formen des Holocaust-Gedenkens in schweizerischen und transnationalen Perspektiven, Köln 2021, S. 161-190.
3 Inschrift der Gedenktafel an der Paul-Grüninger-Brücke in Diepoldsau SG, eingeweiht 2012.
4 Inschrift auf dem Gedenkstein für Céline und Simon Zagiel-Mokobodzki auf dem jüdischen Friedhof in Bern, eingeweiht 1997.
5 Vgl. Kapp, Jean-Pierre: «Flügel des Friedens» in Genf, in: Neue Zürcher Zeitung, 14.12.1998, S. 11.
6 Motion 21.3181 Heer vom 16.3.2021 sowie Motion 21.3172 Jositsch vom 15.3.2021: «Schweizer Ort der Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus».
7 Vgl. Medienmitteilung des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten (EDA), 26.04.2023, <https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-94582.html> [Stand: 2.8.2024].
8 Medienmitteilung des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten (EDA) zur Übergabe des Vorsitzes der International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) an Italien, 6.3.2018, <https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-70013.html> [Stand: 2.8.2024].