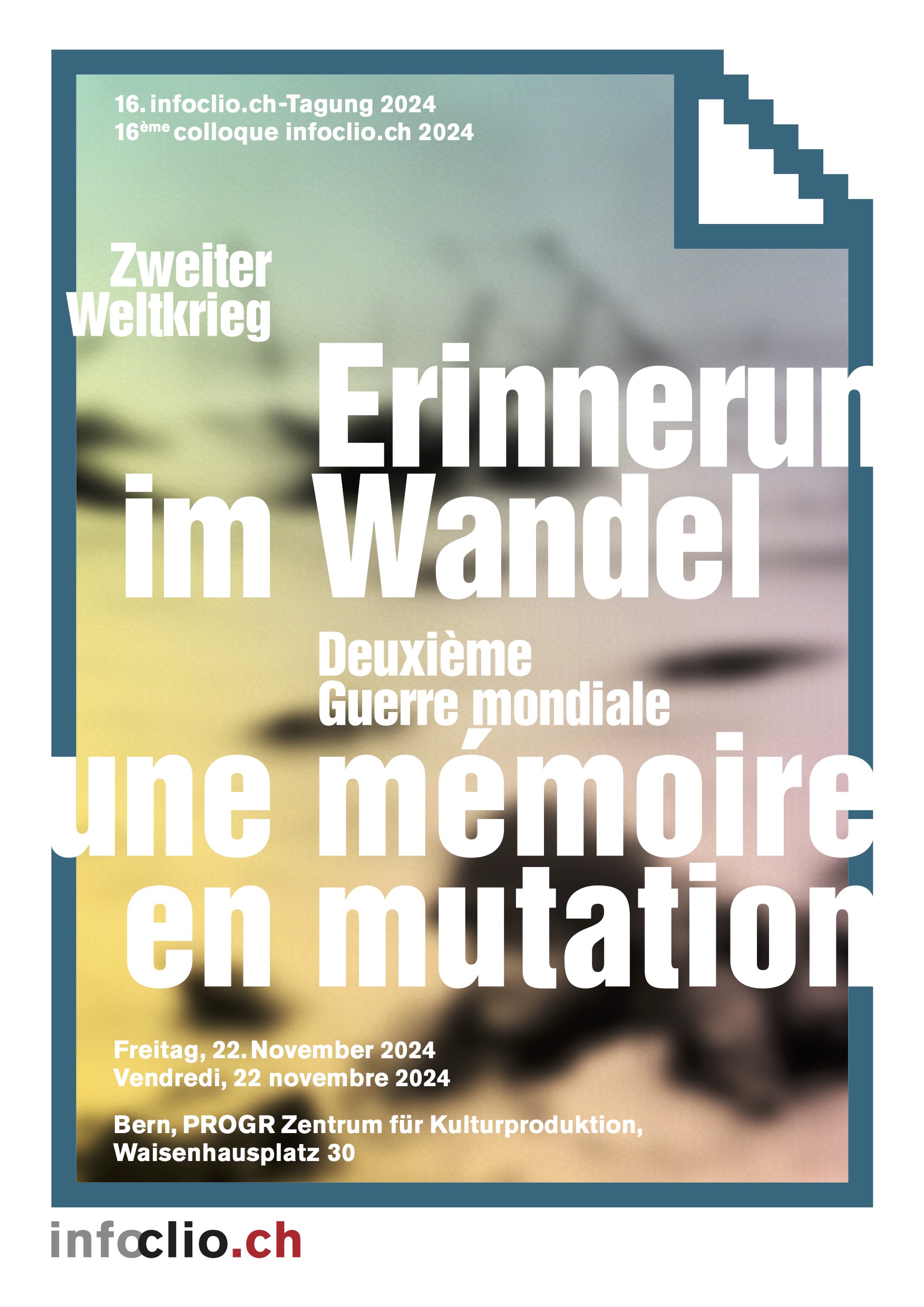Beitrag von Anna Voser, Helen Kaufmann und Thomas Metzger, Pädagogischen Hochschule St. Gallen (PHSG)
«Stürzen wir uns nicht ins Verderben? Handeln wir nicht falsch? Noch nie bin ich vor einer so schwierigen Entscheidung gestanden. […]
---- Adieu Theresienstadt!!! ----.»1
So beschrieb die damals 15-jährige Ruth Brössler am 12. Februar 1945 in St. Gallen in ihrem Tagebuch die einige Tage zuvor im Ghetto Theresienstadt gefällte Entscheidung, sich für den Transport in die Schweiz anzumelden. Transporte in ein neutrales Land statt in Vernichtungslager waren höchst ungewöhnlich und das Vertrauen der Inhaftierten in die Glaubwürdigkeit dieser Möglichkeit war entsprechend gering. Tatsächlich verliess ein Rettungstransport am 5. Februar 1945 das Ghetto, um 1200 Menschen, die von NS-Deutschland als Jüdinnen und Juden verfolgt wurden, via Kreuzlingen nach St. Gallen zu bringen. Der Rettungsaktion gingen komplexe Verhandlungen zwischen dem jüdischen Schweizer Ehepaar Recha und Yitzchok Sternbuch, Alt-Bundesrat Jean-Marie Musy und hochrangigen SS-Funktionären, darunter Heinrich Himmler, voraus. Am 7. Februar 1945 erreichten die 1200 Befreiten St. Gallen und wurden im damaligen Schulhaus Hadwig, das heute Teil des Campus der Pädagogischen Hochschule St. Gallen ist, untergebracht. Ungefähr 200 Personen wurden aus Platzgründen in eine leerstehende Fabrik in Bühler AR gebracht. Nur wenig ist in der Schweiz über diese erfolgreiche Befreiungsaktion und die weiteren Lebenswege der Passagier:innen dieses «Zugs in die Freiheit» bekannt – die offizielle Schweiz mit ihrer damals von Antisemitismus geprägten, restriktiven Flüchtlingspolitik, gewährte nur wenigen von ihnen dauerhaft Asyl.

Bild: StadtASG PA Scheiwiller Walter 25
An diesem Punkt setzt die Fachstelle Demokratiebildung und Menschenrechte der Pädagogischen Hochschule St. Gallen an. Seit 2021 werden gemeinsam mit Partner:innen aus Deutschland (Freie Universität Berlin), Tschechien (Karls-Universität Prag) und den Niederlanden (Austria Centre Leiden) die Befreiungsaktion und die Lebenswege der Passagier:innen des «Zugs in die Freiheit» geschichtswissenschaftlich erforscht. Das Ergebnis dieser Forschung wird im Februar 2025 im Buch «Wir machen einen grossen Schritt ins Leben». Die Befreiten aus dem Ghetto Theresienstadt in der Schweiz: Lebenswege und Erinnerungen veröffentlicht. Die Publikation bildet die Grundlage für Vermittlungsangebote, die ab Ende 2026 Schulklassen und der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen werden. Das Forschungsprojekt sieht sich als Beitrag zu einer akteur:innenzentrierten, transnationalen (Gewalt-)Migrationsgeschichte. Der Fokus liegt auf den 1200 Befreiten, die nicht nur als Forschungsgegenstand, sondern als Subjekte mit – wenn auch eingeschränkten – Handlungsspielräumen betrachtet werden. So machen – nebst kontextualisierenden Kapiteln zur Befreiungsaktion und quantitativen Aussagen zu soziodemografischen Faktoren der 1200 Personen – biografische Fallstudien zu einzelnen Befreiten einen grossen und wichtigen Teil des Buches aus. Darin wird ein Schwerpunkt auf die Reflexionen, Interaktionen und subjektiven Wahrnehmungen der Individuen während ihren von (Gewalt-)Migrationserfahrungen geprägten Lebenswegen gelegt.2

Bild: StadtASG PA Scheiwiller Walter 23
Nicht nur in der Geschichtswissenschaft, auch in der Geschichtsdidaktik ist in den letzten Jahren und Jahrzehnten eine Hinwendung zum Individuum festzustellen. Der auch im Projekt «Zug in die Freiheit» verfolgte biografische Ansatz orientiert sich am geschichtsdidaktischen Prinzip der Personifizierung. So werden nicht «berühmte Persönlichkeiten», wie es bis weit ins 20. Jahrhundert in der Geschichtswissenschaft und -vermittlung üblich war, in den Vordergrund gerückt, sondern die Geschichten der «kleinen», «gewöhnlichen» Menschen und deren Handlungsspielräume.3

Bild: StadtASG PA Scheiwiller Walter 04
Das Vermittlungsangebot besteht aus drei Teilprojekten: Erinnerungsort mit Ausstellung, Website und Unterrichtsmaterialien. Die Unterrichtsmaterialien richten sich primär an Schulklassen der Sekundarstufe I. Konkret sind ein «Biografiekoffer» und zwei «IWalks» geplant. Anhand der im «Biografiekoffer» enthaltenen Quellenmaterialien können die Schüler:innen die Lebenswege von rund 20 Transportteilnehmenden rekonstruieren und als Narration in Form einer Kurzbiografie präsentieren. Die «IWalks» basieren auf einer App des Visual History Archives der USC Shoah Foundation und ermöglichen multimediale Rundgänge entlang historischer Schauplätze mithilfe von videografierten Zeitzeug:innen-Interviews. Die Erinnerungsorte mit Ausstellung werden an den historischen Schauplätzen im Hadwig Gebäude der Pädagogischen Hochschule St. Gallen und auf dem Gelände des damaligen Flüchtlingslagers in Bühler AR erstellt. Die Scharnierfunktion zwischen diesen Projekten nimmt die Website ein, die sich an die breite Öffentlichkeit richtet. Sie wird mit den QR-Codes in den Ausstellungen und den digitalen Unterrichtsmaterialien verknüpft. Auch finden sich auf ihr Kontextinformationen zur Rettungsaktion und einen Zugang zur Datenbank der befreiten Personen. Das Forschungs- und Vermittlungsprojekt «Zug in die Freiheit» soll mithilfe des akteur:innenzentrierten Zugangs einen Beitrag zur transnationalen Erinnerungskultur leisten.
Anmerkungen
1 European Holocaust Reseach Infrastructure, Brössler Ruth: Tagebuch, Eintrag vom 12.02.1945, in: JMP, DOCUMENT.JMP.SHOAH/T/2/A/10h/324a/003c.
2 Vgl. Skenderovic Damir: Vom Gegenstand zum Akteur. Perspektivenwechsel in der Migrationsgeschichte der Schweiz, in: Schweizerische Zeitschrift für Geschichte 65 (2015), S. 1–14. hier, S. 1–14.
3 Vgl. Gautschi Peter: Vom Nutzen des Biografischen für das historische Lernen, in: Bildungs- und Kulturdepartement des Kantons Luzern (BKD) (Hg.): Menschen mit Zivilcourage – Mut, Widerstand und verantwortliches Handeln in Geschichte und Gegenwart, Luzern 2015, S. 171-179, hier S. 172.