Seit Anbruch des digitalen Zeitalters ist immer wieder von einer radikalen Transformation der Zeitregime die Rede. «Präsentismus», «Beschleunigung» und «Krise der Zukunft» sind einige der Formulierungen zur Beschreibung dieser Veränderungen. Ist die Zeit wirklich aus den Fugen geraten? Die 8. infoclio.ch-Tagung thematisiert Zeitvorstellungen in einer historischen Perspektive und fragt nach den Auswirkungen der digitalen Medien auf die Zeitregime.
Aufstieg und Niedergang des modernen Zeitregimes

Der Beitrag fragt nach dem Umgang mit Zeit, nach der Diskursivität von Zeit in der Geschichtsschreibung des 19. und der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.
Der Beitrag fragt nach dem Umgang mit Zeit, nach der Diskursivität von Zeit in der Geschichtsschreibung des 19. und der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Zeit als Wahrnehmungsmuster beeinflusst Modi und Ausformungen der Konstruktion von Erinnerung – von Geschichtsschreibung wie von anderen Erinnerungsmodi –, während letztere ihrerseits Zeitkonzeptionen und Deutungen von Zeit strukturieren und festschreiben. Es sollen Wege der Tiefenanalyse des Funktionierens von Erinnerungsdiskursen mit speziellem Blick auf die Geschichtsschreibung aufgezeigt werden, wobei ein dreifacher Fokus verfolgt wird: auf diskursive Dimensionen, welche Zeitwahrnehmung und Zeitdeutung zum Ausdruck bringen, auf deren Konstruktionslogiken sowie auf die Narrativität von Zeit, Geschichte und Gedächtnis.
Pfahlbauer auf Sulawesi. Wissenschaft und koloniales Zeitregime in der Schweiz
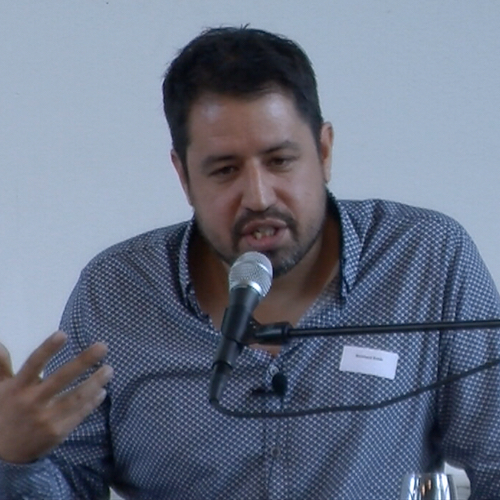
Die europäische Erfindung der Zeit und die Eroberung aussereuropäischer Räume gingen ab dem 18. Jahrhundert Hand in Hand.
Die europäische Erfindung der Zeit und die Eroberung aussereuropäischer Räume gingen ab dem 18. Jahrhundert Hand in Hand. Dies führte zu einer spezifischen Form des kolonialen Denkens, die der deutsch-amerikanische Anthropologe Johannes Fabian vor etlichen Jahren als die „Verweigerung der Gleichzeitigkeit“ beschrieben hat. Während europäische Gesellschaften die Gegenwart, die Kultur, die Moderne und den Fortschritt verkörperten, wurden kolonisierte Gesellschaften als Repräsentantinnen und Repräsentanten einer europäischen „Urvergangenheit“ wahrgenommen. Sie lebten angeblich in einem Zustand Natürlichkeit, Ursprünglichkeit, Rückständigkeit und des Stillstands.
In meinem Vortrag zeige ich anhand der „Entdeckung“ der Pfahlbauer in den 1850er Jahren, wie die „Verweigerung der Gleichzeitigkeit“ die Anfänge der wissenschaftlichen „Urgeschichte“ in der Schweiz formte und ihre Entwicklung bis ins 20. Jahrhundert mitgestaltete.