Depuis l’avènement de l’ère numérique, de nombreux observateurs partagent le constat d’une transformation radicale des régimes temporels. « Présentisme », « Accélération », « Crise de l’avenir » sont quelques-unes des formules employées pour décrire ce changement. Le temps serait-il réellement sorti ses gonds ? Le 8 ème colloque infoclio.ch aborde les perceptions du temps dans une perspective historique et questionne les effets des médias numériques sur les régimes temporels.
Aufstieg und Niedergang des modernen Zeitregimes

Der Beitrag fragt nach dem Umgang mit Zeit, nach der Diskursivität von Zeit in der Geschichtsschreibung des 19. und der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.
Der Beitrag fragt nach dem Umgang mit Zeit, nach der Diskursivität von Zeit in der Geschichtsschreibung des 19. und der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Zeit als Wahrnehmungsmuster beeinflusst Modi und Ausformungen der Konstruktion von Erinnerung – von Geschichtsschreibung wie von anderen Erinnerungsmodi –, während letztere ihrerseits Zeitkonzeptionen und Deutungen von Zeit strukturieren und festschreiben. Es sollen Wege der Tiefenanalyse des Funktionierens von Erinnerungsdiskursen mit speziellem Blick auf die Geschichtsschreibung aufgezeigt werden, wobei ein dreifacher Fokus verfolgt wird: auf diskursive Dimensionen, welche Zeitwahrnehmung und Zeitdeutung zum Ausdruck bringen, auf deren Konstruktionslogiken sowie auf die Narrativität von Zeit, Geschichte und Gedächtnis.
Pfahlbauer auf Sulawesi. Wissenschaft und koloniales Zeitregime in der Schweiz
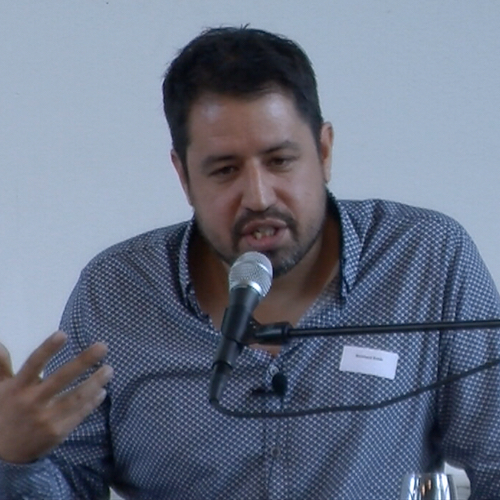
Die europäische Erfindung der Zeit und die Eroberung aussereuropäischer Räume gingen ab dem 18. Jahrhundert Hand in Hand.
Die europäische Erfindung der Zeit und die Eroberung aussereuropäischer Räume gingen ab dem 18. Jahrhundert Hand in Hand. Dies führte zu einer spezifischen Form des kolonialen Denkens, die der deutsch-amerikanische Anthropologe Johannes Fabian vor etlichen Jahren als die „Verweigerung der Gleichzeitigkeit“ beschrieben hat. Während europäische Gesellschaften die Gegenwart, die Kultur, die Moderne und den Fortschritt verkörperten, wurden kolonisierte Gesellschaften als Repräsentantinnen und Repräsentanten einer europäischen „Urvergangenheit“ wahrgenommen. Sie lebten angeblich in einem Zustand Natürlichkeit, Ursprünglichkeit, Rückständigkeit und des Stillstands.
In meinem Vortrag zeige ich anhand der „Entdeckung“ der Pfahlbauer in den 1850er Jahren, wie die „Verweigerung der Gleichzeitigkeit“ die Anfänge der wissenschaftlichen „Urgeschichte“ in der Schweiz formte und ihre Entwicklung bis ins 20. Jahrhundert mitgestaltete.
Wireless telegraphy and synchronisation of time. A transnational perspective

Wireless telegraphy and synchronisation of time. A transnational perspective
This paper, based on unpublished documents of the International Telecommunication Union’s archive and radio amateurs' magazines, discusses the multiform
This paper, based on unpublished documents of the International Telecommunication Union’s archive and radio amateurs' magazines, discusses the multiform relationships between wireless telegraphy and time at the beginning of the 20th century. Specifically, it aims to analyze how time synchronization and wireless telegraphy depend on and refer to each other, explicitly and implicitly.
First, wireless became an essential infrastructure for time synchronization, when in 1912 the International Time Conference inaugurated the network of signaling stations with the Eiffel tower. Second, radio time signals brought forward the development of wireless and became one of the first widely accepted forms of radio broadcasting. Finally, this relation between time and wireless later evolved in new unforeseen applications that led to the development of other technologies, such as aviation and seismology. In conclusion, wireless generated new ideas, affected different technological fields, and changed the perception of distance and time.
Wie die Schweiz auf die gleiche Uhrzeit kam

Noch um 1800 existierten in der Schweiz unterschiedliche Zeitstrukturen: Die Zeitangabe bei der Einladung zu einem Treffen in Bern am 14. Oktober um 09.30 Uhr hätte für jemanden aus Lugano, Zürich, Genf oder Basel nicht den gleichen Zeitpunkt bezeichnet.
Noch um 1800 existierten in der Schweiz unterschiedliche Zeitstrukturen: Die Zeitangabe bei der Einladung zu einem Treffen in Bern am 14. Oktober um 09.30 Uhr hätte für jemanden aus Lugano, Zürich, Genf oder Basel nicht den gleichen Zeitpunkt bezeichnet. Je nachdem, ob sich jemand nach der italienischen Zeit, der wahren Lokalzeit, der mittleren Lokalzeit, der Berner Zeit oder der mitteleuropäischen Zeit gerichtet hätte, wäre er oder sie zu einem anderen Zeitpunkt zur Veranstaltung in Bern erschienen. Die Zeit war an astronomische Phänomene gekoppelt, die je nach Ort unterschiedlich waren. Im Laufe des 19. Jahrhunderts mussten die unterschiedlichen Tageseinteilungen und Stundenzählungen einem einheitlichen System Platz machen. Verantwortlich dafür waren die zunehmende gesellschaftliche Verdichtung und die internationale Verflechtung. Seit 1894 richtet sich die Schweiz nach der mitteleuropäischen und damit nach der gleichen Zeit. Seither bestimmt nicht mehr ein auf die Schweiz bezogenes astronomisches Phänomen die Zeitordnung in der Schweiz, sondern eine internationale Übereinkunft.
L’avènement de la synchronisation entre demande et production du temps (1850-1910)

Le processus de synchronisation est généralement attribué à la mise en place de réseaux infrastructurels au cours de la deuxième moitié du XIXe siècle. Télégraphie et chemins de fer mettent en évidence les particularismes du temps local, qui imposent une uniformisation nationale et internationale.
Le processus de synchronisation est généralement attribué à la mise en place de réseaux infrastructurels au cours de la deuxième moitié du XIXe siècle. Télégraphie et chemins de fer mettent en évidence les particularismes du temps local, qui imposent une uniformisation nationale et internationale. En Suisse, la création de l’Observatoire chronométrique de Neuchâtel en 1858, la communication électrique de l’heure et la multiplication des horloges publiques investissent et transforment le territoire. Pourtant, il y a une autre forme technique qu’il faut interroger pour comprendre le processus de synchronisation : la portabilité des garde-temps. Forme individuelle de la consommation du temps, la montre connaît des changements importants au cours de la deuxième moitié du XIXe siècle. La forte augmentation de la production de pièces à bon marché et la délocalisation de la montre de la poche au poignet entraînent une diffusion sociale des nouveaux gestes du contrôle individuel du temps. La montre devient ainsi le relais d’une synchronisation par laquelle l’individu intériorise les contraintes et les représentations liées à une nouvelle économie du temps.
Informationmanagement as time production

Zeit spielt im Infomanagement vor allem im Konzept des Lebenszyklus von Akten eine entscheidende Rolle. Akten bzw. Unterlagen eignet eine eigene Lebenszeit: eine Akte wird angelegt, laufend bearbeitet, nach Abschluss des
Zeit spielt im Infomanagement vor allem im Konzept des Lebenszyklus von Akten eine entscheidende Rolle. Akten bzw. Unterlagen eignet eine eigene Lebenszeit: eine Akte wird angelegt, laufend bearbeitet, nach Abschluss des Geschäfts noch gelegentlich konsultiert bevor sie dann archiviert oder vernichtet wird. Akten haben mitunter eine Art Nachleben, wenn sie als Archivgut ganz neue Verwendungszwecke jenseits ihres ursprünglichen Verwendungszweckes und Entstehungskontextes erfahren oder diesen in komplett neuem Licht beleuchten. Akten eignet zugleich aber auch eine Vorzeitigkeit, wenn sie in Ordnungssystemen (früher Registraturplänen) nicht nur einen prägenden Informationskontext erhalten, sondern wenn sie darüber hinaus (als nicht oder archivwürdig) bewertet werden, bevor sie überhaupt entstanden sind. Über die Existenz(weise) von Unterlagen entscheiden Informationsmanager, bevor es Unterlagen überhaupt gibt. Informationsmanagement figuriert dann eine komplexe Zeitlichkeit, in der drei Zeitschichten miteinander interagieren: eine Lebenszeit der Akten, die durch ihren Stellenwert in einem Ordnungssystem präfiguriert ist, und ein Nachleben der Akten, dass weniger von der Lebenszeit der Akten, als vielmehr von einer Bewertung bestimmt ist, die der Existenz von Akten vorausgeht. Archivgut verkörpert dann eine veritable Ungleichzeitigkeit des Gleichzeitigen. Dieses komplexe Zeitsystem bewirkt zudem, dass die Aktenproduzierenden sich in ihrer Gegenwart immer auch schon in einer künftigen Vergangenheit sehen und somit potentiell alle Überreste zu Traditionsquellen werden.
Société, instruments et temporalité

Cette communication se veut une réflexion cherchant à comprendre comment les techniques ont modifié le rapport de l’humain à la temporalité, notamment en direction d’un sentiment d’accélération du temps à partir de l’époque contemporaine.
Cette communication se veut une réflexion cherchant à comprendre comment les techniques ont modifié le rapport de l’humain à la temporalité, notamment en direction d’un sentiment d’accélération du temps à partir de l’époque contemporaine. La temporalité est prise ici sous les diverses instances du rapport de l’homme au temps, aussi bien dans sa partie impensée – les pratiques mises en œuvre dans la sphère d’utilisation d’une techné – que dans sa partie symbolique : les conceptions temporelles qui en accompagnent l’utilisation, telles que les idées de progrès ou de perspective, les utopies ou les modèles de la mémoire.
Pour cela, j’analyserai et mettrai en relation entre eux différents schèmes temporels dans lesquels l’emploi d’une techné aboutit à modifier le rapport de ses utilisateurs au temps : le rapport entre le nouveau et l’ancien, créateur d’irréversibilité ; le temps d’établissement d’une technè dans la société, sa durée de vie, etc.
Enfin, je m’interrogerai également sur les modifications des structures cognitives liées à l’utilisation de certaines techné et pour cela j’utiliserai d’autres indicateurs temporels tels que la perception de l’horizon temporel des acteurs durant l’histoire, les postures émotionnelles, de l’euphorie à la révolte face à de nouvelles technès ; ou encore la perception du temps dans l’histoire, de la lenteur à la vitesse.
«Die Alamannen kommen!» - Numismatik des 3. Jahrhunderts n. Chr. und ihre Interpretation

Die "Schatzfund-Horizonte" in der römischen Schweiz des 3. Jahrhunderts n. Chr. wurden lange als Zeugen von Alamannen-Einfällen gedeutet. Perioden mit wenigen Münzfunden galten als Belege für deren zerstörerische Überfälle, die ganze Landstriche entvölkert hatten.
Die "Schatzfund-Horizonte" in der römischen Schweiz des 3. Jahrhunderts n. Chr. wurden lange als Zeugen von Alamannen-Einfällen gedeutet. Perioden mit wenigen Münzfunden galten als Belege für deren zerstörerische Überfälle, die ganze Landstriche entvölkert hatten. Heute zeichnen Archäologen und Numismatiker ein differenzierteres Bild.
Was ist ein Schatzfund, ein Hort? Wie wird er datiert? Warum werden solche angesammelt, dem Boden anvertraut und nie mehr gehoben? Warum liegen gerade aus dem 3. Jahrhundert n. Chr. so viele Horte vor? Anhand der Methoden der archäologischen Numismatik soll aufgezeigt werden, wie Münzen als archäologische Quelle interpretiert werden und welche Rückschlüsse sie auf die historische und wirtschaftshistorische Entwicklungen des 3. Jahrhunderts erlauben.
«Die Alamannen kommen!» - Numismatik des 3. Jahrhunderts n. Chr. und ihre Interpretation

Die "Schatzfund-Horizonte" in der römischen Schweiz des 3. Jahrhunderts n. Chr. wurden lange als Zeugen von Alamannen-Einfällen gedeutet. Perioden mit wenigen Münzfunden galten als Belege für deren zerstörerische Überfälle, die ganze Landstriche entvölkert hatten.
Die "Schatzfund-Horizonte" in der römischen Schweiz des 3. Jahrhunderts n. Chr. wurden lange als Zeugen von Alamannen-Einfällen gedeutet. Perioden mit wenigen Münzfunden galten als Belege für deren zerstörerische Überfälle, die ganze Landstriche entvölkert hatten. Heute zeichnen Archäologen und Numismatiker ein differenzierteres Bild.
Was ist ein Schatzfund, ein Hort? Wie wird er datiert? Warum werden solche angesammelt, dem Boden anvertraut und nie mehr gehoben? Warum liegen gerade aus dem 3. Jahrhundert n. Chr. so viele Horte vor? Anhand der Methoden der archäologischen Numismatik soll aufgezeigt werden, wie Münzen als archäologische Quelle interpretiert werden und welche Rückschlüsse sie auf die historische und wirtschaftshistorische Entwicklungen des 3. Jahrhunderts erlauben.
«Die Alamannen kommen!» - Numismatik des 3. Jahrhunderts n. Chr. und ihre Interpretation

Die "Schatzfund-Horizonte" in der römischen Schweiz des 3. Jahrhunderts n. Chr. wurden lange als Zeugen von Alamannen-Einfällen gedeutet. Perioden mit wenigen Münzfunden galten als Belege für deren zerstörerische Überfälle, die ganze Landstriche entvölkert hatten.
Die "Schatzfund-Horizonte" in der römischen Schweiz des 3. Jahrhunderts n. Chr. wurden lange als Zeugen von Alamannen-Einfällen gedeutet. Perioden mit wenigen Münzfunden galten als Belege für deren zerstörerische Überfälle, die ganze Landstriche entvölkert hatten. Heute zeichnen Archäologen und Numismatiker ein differenzierteres Bild.
Was ist ein Schatzfund, ein Hort? Wie wird er datiert? Warum werden solche angesammelt, dem Boden anvertraut und nie mehr gehoben? Warum liegen gerade aus dem 3. Jahrhundert n. Chr. so viele Horte vor? Anhand der Methoden der archäologischen Numismatik soll aufgezeigt werden, wie Münzen als archäologische Quelle interpretiert werden und welche Rückschlüsse sie auf die historische und wirtschaftshistorische Entwicklungen des 3. Jahrhunderts erlauben.
«Die Alamannen kommen!» - Numismatik des 3. Jahrhunderts n. Chr. und ihre Interpretation

Die "Schatzfund-Horizonte" in der römischen Schweiz des 3. Jahrhunderts n. Chr. wurden lange als Zeugen von Alamannen-Einfällen gedeutet. Perioden mit wenigen Münzfunden galten als Belege für deren zerstörerische Überfälle, die ganze Landstriche entvölkert hatten.
Die "Schatzfund-Horizonte" in der römischen Schweiz des 3. Jahrhunderts n. Chr. wurden lange als Zeugen von Alamannen-Einfällen gedeutet. Perioden mit wenigen Münzfunden galten als Belege für deren zerstörerische Überfälle, die ganze Landstriche entvölkert hatten. Heute zeichnen Archäologen und Numismatiker ein differenzierteres Bild.
Was ist ein Schatzfund, ein Hort? Wie wird er datiert? Warum werden solche angesammelt, dem Boden anvertraut und nie mehr gehoben? Warum liegen gerade aus dem 3. Jahrhundert n. Chr. so viele Horte vor? Anhand der Methoden der archäologischen Numismatik soll aufgezeigt werden, wie Münzen als archäologische Quelle interpretiert werden und welche Rückschlüsse sie auf die historische und wirtschaftshistorische Entwicklungen des 3. Jahrhunderts erlauben.
«Algorithmisierte Klio»: Technische Chronopoetik versus klassische Geschichtszeit

Seit Einführung der Kulturtechnik Schrift schreibt sich die symbolische Ordnung von Zeit in Form diskreter Zeichern, doch der narrative Gestus von Historiographie hat diese Konfiguration lange zugunsten von Kontinuitätseffekten verdeckt.
Seit Einführung der Kulturtechnik Schrift schreibt sich die symbolische Ordnung von Zeit in Form diskreter Zeichern, doch der narrative Gestus von Historiographie hat diese Konfiguration lange zugunsten von Kontinuitätseffekten verdeckt.
In Zeiten der Digital Humanities kommt es nicht nur zu einer Algorithmisierung Kleios, resultierend in nonlinearen Zeitsprüngen; induziert durch technologische Speicher- und Kommunikationsmedien zeichnen sich grundsätzliche Alternativen zum (im doppelten Sinne) "historischen" Zeitbewußtsein zugunsten einer Pluralität anderer Figuren dynamischer Prozessualität ab. Neben historiographische Vorstellungen von Zeitordnungen tritt die diagrammatische Konstruktionen alternativer Temporalitäten. Aus aktueller Perspektive sind dies die Figuren der Programmierung: Schleifen, Rekursionen.
Auf der Spur anderer Zeitverhältnisse schreibt sich archäographische Signalzeit und Historiogramme.
Geschichtswissenschaftliche Forschung verliert demgegenüber das diskursive Primat der Definition emphatischer Zeit, bleibt aber im Reigen der techno-kulturellen Chronopoetik ein notwendiges, codekritisches Korrektiv.
weniger
La modélisation du temps dans les Digital Humanities

Les interfaces numériques sont chaque jour optimisées pour proposer des navigations sans frictions dans les multiples dimensions du présent.
Les interfaces numériques sont chaque jour optimisées pour proposer des navigations sans frictions dans les multiples dimensions du présent. C’est cette fluidité, caractéristique de ce nouveau rapport à l’enregistrement documentaire, que les Digital Humanities pourraient réussir à reintroduire dans l’exploration du passé. Un simple bouton devrait nous permettre de glisser d’une représentation du présent à la représentation du même référent, il y a 10, 100 ou 1000 ans. Idéalement, les interfaces permettant la navigation dans le temps devraient pouvoir offrir la même agilité d’action que celle nous permettent de zoomer et des zoomer sur des objets aussi larges et denses que le globe terrestre. La recherche textuelle, nouvelle porte d’entrée de la connaissance depuis le le XXIe siècle devrait pouvoir s’étendre avec la même simplicité aux contenus des documents du passé. La recherche visuelle, second grand moment de l’indexation du monde et dont les premiers résultats commencent à s’inviter sur la quotidienneté de nos pratiques numériques, pourrait être la clé de voute de l’accès aux milliards de documents qu’il nous faut maintenant rendre accessible sous format numérique. Pour rendre le passé présent, il faudrait le restructurer selon les logiques des structures de la société numérique. Que deviendrait le temps dans cette transformation ? Une simple nouvelle dimension de l’espace ? La réponse est peut-être plus subtile.